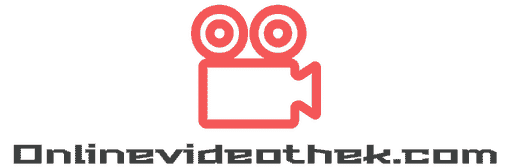C-Movie Mockbuster
USA, 2012: Warum Geschichtswissen dem kommerziellen Erfolg in den Weg stellen? The Asylum — Schöpfer von „Transmorphers“ & Trash, mindestens seit „Titanic 2“ vielen ein Begriff — lassen wieder fürchterlich zulangen, diesmal von Präsident Lincoln höchstpersönlich. USA, 1863, ungefähr Dienstag Nachmittag, und draußen tobt der Amerikanische Bürgerkrieg. Ungerührt geht die Killerparodie neben „Abraham Lincoln: Vampire Hunter“ (Twentieth Century Fox) ungezählten Zombies an den blutigen Kragen. Kurzweilig und erdig kommt dieser Gruselwestern in den ersten Minuten daher, um sich später unter der Regie von Richard Schenkman zäh durch eine Zombie-Legion zu splattern.
Eigentlich sollte sich Mr. Lincoln alias Bill Oberst Jr. auf seinen Kleinkrieg mit den Konföderierten konzentrieren, wenn da nicht einer
tödlicheren Bedrohung zu begegnen wäre: echten Zombies! Sichelschwingend und Moses gleich macht sich HErr Lincoln also mit zwölf soldatischen Jüngern auf und aus lebenden Toten garantiert tote Tote. Wem dieser schwarze Humor nicht subtil genug ist, für den kämpft als einziger Afroamerikaner Soldat Brown an des Präsidenten Seite. Ähnlich schwarz-weiß poltert der Rest des Streifens mit pseudo-authentischem Sepia-Farbstich über die Leinwand: Präsident gut, Zombies richtig böse!
Kein Wunder, werden diese doch von den Konföderierten in einem Fort in South Carolina gezüchtet, was allerdings ein wenig aus dem Ruder läuft oder so ähnlich. Ganz Alpha-Tier, führt Mr. President jedenfalls sein Z-Team gen Süden, wo mittlerweile eine vierstellige Zombie-Zahl seiner harrt — har har! Politische Differenzen dürfen angesichts einer veritablen Leichenplage einmal ignoriert werden, und so verbündet sich Abe mit den konträren Konföderierten und lässt Köpfe rollen. Alles etwas zu brutal? Aber sichel doch!
Ähnlich zerschnitten wie die Toten ist leider auch der Film, dem etwas Liebe in der billigen Postproduktion nicht geschadet hätte. Letztlich
lässt sich dieses Manko mit Hinweis auf das Trash-Genre der Handlung noch entschuldigen. Aus diesem Blickwinkel machen selbst die schlecht sitzenden Uniformen der Konföderierten, ihre plastikähnliche Bewaffnung und die angeklebte Gesichtsbehaarung fast Sinn, so wie die auch aus dem 19. Jahrhundert stammenden Spezialeffekte, und echter Horror ergreift einen angesichts des laienhaften Zombie-Make-ups.
Passend unpassend ist die Tonbearbeitung geraten, die oft die schlitzende Sichel mit dumpfem Schlaggeräusch synchronisiert. Da
fallen gar nicht übel geratene musikalische Themen merkwürdig angenehm aus dem Rahmen. Trash hin, Cash her, unverzeihlich bleibt die tödliche Langeweile, die sich mangels Plot spätestens nach der ersten halben Stunde breitmacht und selbst Zombies vermehrt zur Fernbedienung greifen lässt. Der originellen Grundidee des Streifens — Knabe Abe muss infizierte Mutter metzeln und Abraham-Mann kann diese Erfahrung gut verwerten — folgt keine stringente und kompakte Umsetzung. Zombiekopf und schief geklebter Bart sind ab! Da verpufft auch das emotionale Glanzlicht des Drehbuchs, das — huch! — ganz zufällige Treffen Lincolns mit seiner glücklichen Jugendliebe, wirkungslos.
Ein spannenderes Heldenepos hätte der sechzehnte Präsident der Vereinigten Staaten allemal verdient, war doch bereits sein eigenes Ableben per Attentat aufregender als Asylums 90-Minuten-Versuch einer Moritat. Immerhin zwinkert dieser mausetote Streifen Abraham Lincoln zu, wenn Booth, der Mörder des Präsidenten, gegen Filmende in Erscheinung tritt. Die geschätzten Billigproduktionskosten von nur 1.500 Dollar je Filmminute lassen sich per Salamitaktik — ein Zombie, noch einer — nicht zu Spannung verdichten. Entsprechend spielt auch der Großteil des Machwerks ausschließlich in der Untoten-Festung South Carolinas. Selbst Asylums eingebunkerte „Nazis At The Center Of The World“ haben wir in umtriebigerer Erinnerung.
Wenigstens wird der historische Kontext des Konflikts nicht völlig vernachlässigt, nur gräulich verzerrt. Einer der auf Lincoln folgenden Präsidenten, nämlich Teddy Roosevelt, spielt als junger Teen eine kleine Rolle im dünnen Geschehen, wenngleich das Original bestenfalls fünf Jahre alt gewesen sein dürfte. Was einen New Yorker Jungen allerdings während eines erbost geführten Bürgerkriegs in die Südstaaten treibt, bleibt des Drehbuchautors Geheimnis.
So zieht sich das lahme Treiben der Handlung über eine Stunde hin, wobei die Toten, ganz realistisch, nicht sonderlich kämpferisch
auftreten und gelegentliche stehend schlafen. Dem Betrachter dieser Szenen geht es recht ähnlich. Wie kommt es also, dass die kampferprobten Recken des Präsidenten nach und nach ableben? Flucht aus der Langeweile? Erstickt am Gähnen? Es bleibt unklar. Jedenfalls endet das Grauen viel zu spät mit eher symbolischen weil unterfinanzierten Explosionen aus dem Heim-Computer.
Fazit ohne Placet: Mäßig gruselige Trashistory tröpfelt blutig, billig und ohne viel Eigenironie durch eine lange Weile mit viel zu
seltener Erheiterung oder Pupillenerweiterung — The Asylum bleibt sich treu. Prädikat: besonders schmerzvoll!